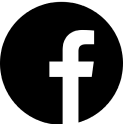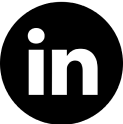Ideen für die Welt von morgen
14.08.2018 | Clublandschaft Hamburg

Im Jahr 2011 landete der Musikjournalist und Clubbetreiber Tino Hanekamp mit seinem Roman „So was von da" einen Bestseller, dessen Verfilmung von Regisseur Jakob Lass am 16. August in die Kinos kommt. Darin beschreibt er die exzessive letzte Nacht eines Hamburger Live-Clubs vor seiner Schließung. Der Begriff des „Clubsterbens" ist nach wie vor ein geflügeltes Wort – doch wie geht es der Hamburger Clublandschaft gerade wirklich? Eine Bestandsaufnahme.
Wer sich am Wochenende mit zahlreichen Touristen und Partyvolk über den Hamburger Kiez treiben lässt, staunt nicht schlecht: Mit geschätzt mehr als 140 Musikspielstätten und jährlich rund 20.000 Musikveranstaltungen steht Hamburg im bundesweiten Vergleich an der Spitze. Zwischen Reeperbahn und Schanze finden sich Institutionen wie die „Große Freiheit 36", das „Gruenspan", das "Docks" oder auch das "Uebel & Gefährlich". Ein Mekka für Liebhaber von Livemusik und auch für Tanzwütige. Kaum jemand würde auf die Idee kommen, dass viele Clubs trotz langer Schlangen vor dem Eingang regelmäßig in die roten Zahlen rutschen – 15 Stück haben in den letzten Jahren ihre Tore geschlossen, darunter bekannte Locations wie "Golem", "Kleine Donner", "Moloch" oder "klubsen". Die Gründe hierfür sind vielfältig – vor allem Faktoren wie Nachverdichtung, Mieterverdrängung und kostspielige Auflagen seien laut Thore Debor, dem Geschäftsführer Clubkombinat Hamburg, für das "Aus" vieler Clubs verantwortlich.

Das Clubkombinat ist der Zusammenschluss der Club- und Veranstalterlandschaft in Hamburg und setzt sich dafür ein, dass sich die Rahmenbedingungen der hiesigen Liveclub-Szene nicht weiter verschlechtern: „Durch die enorm vielen Bauvorhaben in Hamburg müssen wir ganz genau hingucken, was in der Nachbarschaft von Musikspielstätten gebaut werden soll. Sonst werden wir bald eine Club-Verdrängung aus den Kiezen in die Randgebiete beobachten. Die Menschen, die heutzutage in einen Neubau ziehen oder in einem Hotel in unmittelbarer Clubnähe übernachten, sind nicht alle begeisterte Clubgänger und leider sehr geräuschempfindlich. Dazu kommt, dass die Gewerbemieten für Musikbühnen deutlich anziehen, besonders wenn die Nachbarschaft durch Neubauten aufgewertet wird", so Debor. Auch das mittlerweile etablierte Cornern schwächt die Clubs, die oft nur über ihre Gastro-Einnahmen ein Umsatzplus am Ende des Abends verbuchen können. Die Getränke sind am Kiosk um die Ecke eben billiger als im Club - und das Leben in der Großstadt eh schon teuer genug. Auch Jakob Lass, der bei der Romanadaption von „So was von da" Regie führte, hat einige seiner Lieblingsclubs in den letzten Jahren gehen sehen: „In Hamburg sieht man finde ich einen großen Wandel – zumindest im Vergleich zu dem, was ich in meiner Jugend kennengelernt habe. Und besser wird's ja leider nur selten. Damit es besser wird, müsste man sich dafür einsetzen, dass es Räume gibt, die nicht kommerziell funktionieren müssen. Ich finde es wichtig, dass man solche Schutzräume schafft, wo es nicht um Geld, sondern nur um Kultur geht."

Tino Hanekamp hat seine letzte Hamburger Clubnacht bereits hinter sich gebracht und ist vor mehr als fünf Jahren aus dem Clubgeschäft ausgestiegen. Wurde damals auch schon vom Clubsterben gesprochen? „Das Wort schwebte auch damals schon herum. Aber vielleicht ist es auch gar kein Clubsterben, sondern eher die Unmöglichkeit, dass neue Clubs aufmachen können. Ich glaube, dass Clubs manchmal dicht machen, ist für die Clublandschaft kein Problem. Es soll ja Bewegung drin sein. Es gibt jedoch keine Räume für neue Spielstätten – und es ist fast unmöglich, mit all den behördlichen Auflagen einen neuen Club zu finanzieren, das ist echt Wahnsinn! Wir hatten mit der Weltbühne damals eine kleine Nische gefunden und haben ziemlich rumgemogelt – wir wussten, dass jeden Tag die Behörde kommen könnte, um uns den Laden dicht zu machen", sagt Hanekamp, der nach dem Aus der "Weltbühne" das "Uebel & Gefährlich" mitgründete . Was wäre also die Lösung? „Man könnte zum Beispiel versuchen, in jedem Viertel ein leer stehendes Haus nicht gleich abzureißen oder als Eigentumswohnung zu sanieren, sondern Clubbetreibern eine Chance zu geben und zu sagen „hier, macht mal". Gebt den Leuten fünf Jahre, dann schafft einen anderen Raum. Man sollte Gebäude eine Zeit lang zweckentfremden, bevor sie auf den Wohnungsmarkt geworfen werden", sagt Hanekamp. Das wäre natürlich auch bei Neubauten denkbar.
Hamburg, St. Pauli, Silvester. Oskar betreibt einen Musikclub am Ende der Reeperbahn. Sein Leben war ein Fest, doch die Party ist vorbei: Der Club muss schließen, Oskar ist hoch verschuldet. Die letzte Nacht des Clubs wird zur wildesten Party Hamburgs, auf der alle Freunde und Feinde von Oskar aufeinander treffen werden. Oskars zum Star gewordener bester Freund Rocky zerbricht am Ruhm, die lebenslustige Nina malt alles schwarz an, der aggressive Ex-Zuhälter Kiez-Kalle will Oskars Schulden eintreiben und dann sind da noch der tote Elvis, die Innensenatorin und — Mathilda, Mathilda, Mathilda.
Auch Thore Debor findet den Begriff des Clubsterbens nicht passend für die momentane Lage, ein gehyptes Wort, das Ängste schürt, wo es gar nicht sein muss. Auch wenn 15 Clubs geschlossen wurden, haben immerhin sieben Musikbühnen neu eröffnet oder sich vergrößert. Auch müsse man immer beachten, ob es sich um eine freiwillige oder unfreiwillige Schließung handle und ob mit dem "Aus" eines Clubs auch der Einzug eines neuen Clubs ausgeschlossen ist. Sterben sieht also anders aus. Die Behörde für Kultur und Medien hat ihre Mittel für Livemusikclubs in diesem Jahr von 150.000 auf 250.000 Euro erhöht. Ein Zeichen, das die Wichtigkeit der Clubs für Hamburg auch in Politikkreisen unterstreicht. Hamburg ist also dran am Thema, auch wenn laut Thore Debor die immer schlechter werdenden Rahmenbedingungen stets neue und intensivere Anstrengungen erfordern. Und manchmal steckt der Teufel im Detail: „Mein größtes Problem ist momentan das Sommerloch", sagt Susanne Leonhard, die seit mittlerweile acht Jahren "Docks" und "Prinzenbar" auf der Reeperbahn führt. „Wenn mein Chef mich nicht unterstützen würde, dann würde ich in den Sommermonaten jedes Jahr Pleite gehen. Die Leute wollen bei 30 Grad draußen feiern und die Festivals machen uns schwer zu schaffen. Wir haben lediglich drei statt normalerweise rund 15 Veranstaltungen pro Monat. Eigentlich wäre es günstiger, den Club in der Zeit dicht zu machen", so die 55-Jährige. Seit mehreren Jahren ist sie mit dem Clubkombinat auf der Suche nach einer geeigneten Freifläche, welche die Hamburger Clubs auch bei sommerlichen Temperaturen bespielen können – bisher jedoch vergebens.
Oft werden die Clubbesitzer als Gastronomen oder Gewerbetreibende eingestuft. Wer jedoch den Kiez oder die Schanze entlang geht, merkt sehr schnell, dass sich mehr dahinter verbirgt. Man trifft sich zu Events, Kulturereignissen, unvergesslichen Abenden. Man tauscht sich aus und lässt sich inspirieren. „Hier werden die Ideen für die Welt von morgen geboren. Es wäre schön, wenn allgemein anerkannt wird, welchen Stellenwert diese Kulturräume für die Menschen unserer Stadt haben", so Debor. Das Clubkombinat spricht deshalb auch von Kulturraumschutz, ein Begriff, der die Dimension des Schutzes von Clubs und Bars etwas besser veranschaulicht. Doch was kann man als eifriger Konzertbesucher tun, um seine Lieblingsclubs bestmöglich zu unterstützen? Thore Debor nochmal: „Beim Kauf von Konzerttickets im Vorverkauf kann man unser FairTix-System nutzen und somit einerseits Kohle sparen und dennoch 1 Club-Euro pro Ticket an die Clubstiftung spenden (www.fair-tix.de). Eine große Unterstützung ist es außerdem, als Clubgänger auch im Club Getränke zu verzehren. Und wenn man ein Konzert besucht und von dem Künstler begeistert war, gerne CDs oder Schallplatte nach der Show kaufen. Durch den Merchandise-Verkauf halten sich viele Bands über Wasser." Und ganz wichtig: Bei Clubs, die mit Lärmbeschwerden kämpfen, vor der Tür nicht zu laut sein. Klingt ein bisschen nach Spaßbremse, kann aber für den einen oder anderen Club den Unterschied machen.
Trailer - So Was Von Da

Es bleibt also festzuhalten, dass das Clubgeschäft in der heutigen Zeit kein einfaches, aber dafür ein gesellschaftlich extrem wichtiges Geschäft ist. Dass wir weit von einem Clubsterben entfernt sind, aber die Augen offen halten müssen, damit sich die Rahmenbedingungen nicht weiter verschlechtern. Viele Leute antworten, wenn man sie nach ihrem Wunschberuf fragt, mit „eine Bar oder einen Club aufmachen". Kein leichtes Unterfangen, aber dennoch nicht unmöglich: „Wer heutzutage einen Club aufmachen will, muss bereit sein, sein ganzes Leben dafür zu geben. Er oder sie muss Spaß am Job haben, weil man als Clubbetreiber nicht reich wird. Ich kann mir trotzdem nichts anderes vorstellen", sagt Susanne Leonhard, und ihre Augen glänzen. Auch Tino Hanekamp sieht keinen Grund dafür, sich von einer Cluberöffnung abbringen zu lassen: „Einfach machen und bloß keine Angst haben. Fehler und Scheitern sind oft die besten Weichen für dein Leben und bringen dich im Zweifelsfall an die tollsten Orte, von denen du nicht einmal geahnt hast, dass es sie gibt." In diesem Sinne: Wir sind gespannt auf den nächsten Club in Hamburg!
weitere Beiträge