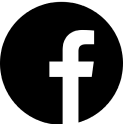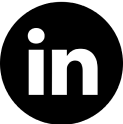.jpg?fit=max&w=800&h=1066&q=90&fm=webp)
Ein Thriller aus dem Alltag
22.09.2017 | Pre-Crime

Eine Software, die voraussagt, wo und wann ein Verbrecher zuschlägt - was nach einem Science-Fiction-Szenario klingt, ist in Städten wie London oder München längst Realität. Die Filmemacher Matthias Heeder und Monika Hielscher aus Hamburg blicken mit ihrer Doku Pre-Crime hinter den Überwachungsstaat und stellen die Frage: Wie viel Freiheit sind wir bereit aufzugeben für das Versprechen absoluter Sicherheit? Wir haben uns anlässlich des Kinostarts am 12. Oktober mit den beiden zu einem Interview getroffen und über die aufwendige Recherche, Big Data und Storytelling in Dokumentation gesprochen.
- Wie seid ihr beiden auf die Idee gekommen, eine Dokumentation über das Thema Pre-Crime zu machen?
Monika Hielscher: Der Auslöser war ein Artikel in der Netzkolumne der Süddeutschen Zeitung, in dem es um die Heat List in Chicago ging. Das war ein sehr kleiner Absatz. Da haben wir uns beim Frühstück angeguckt und gesagt: „Das geht nicht." Es kann nicht sein, dass ein Computer-Algorithmus zur Grundlage polizeilichen Handelns gemacht wird, über den man überhaupt nichts weiß. Anschließend haben wir angefangen zu recherchieren, was das überhaupt ist und sind dann auf die ganzen von der EU finanzierten Überwachungsprogramme gestoßen.
Matthias Heeder: Wir haben dann sehr schnell begriffen, dass wir erzählerisch einen Weg finden müssen, diese unglaubliche Abstraktheit darzustellen. Denn das ist einer der Gründe, warum viele Leute sich nicht für das Thema interessieren. Unser Produzent Stefan Kloos hat uns immer wieder daran erinnert, dass die Frage „Wie berührt das Thema den einzelnen" wichtig ist. Man muss den Menschen zeigen, dass es sie etwas angeht. Wir mussten also schauen, wie wir unsere Bilder bauen. Denn wir haben ja keinen beobachtenden Dokumentarfilm gedreht – das Ganze ist sehr hybrid und künstlich.
Monika Hielscher: Im Anschluss haben wir angefangen, mit Unterstützung unserer Leute in den USA nach Robert McDaniel zu suchen. Denn das war der einzige Name, der in dem Zusammenhang mit der Heat List auftauchte. Denn Rest der Geschichte kann man jetzt auf Leinwand sehen.
- Wo genau sind Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Philip K. Dick's Minority Report und eurer Dokumentation?
Monika Hielscher: Minority Report basiert auf der Vorstellung, dass es Mutanten gibt, die in die Zukunft sehen können und die Polizei bereits vor dem Verbrechen am Tatort ist. Deshalb hassen alle Polizei-Abteilungen, die mit präventiver Polizeiarbeit zu tun haben, den Vergleich mit Minority Report – denn sie können ja eben NICHT in die Zukunft schauen. Von daher ist der Vergleich nur eine Journalistenerfindung, um das Thema Pre-Crime griffig zu machen. Minority Report hat nichts mit Big Data zu tun – und präventive Polizeiarbeit basiert auf nichts anderem. Das ist der große Unterschied.
Matthias Heeder: Pre-Crime ist natürlich der Begriff, den jeder mit Minority Report assoziiert - und mit Zukunft. Als wir in München auf dem Festival liefen, schrieb eine Zeitung, dass wir insgeheim wahrscheinlich lieber einen Thriller gedreht hätten. Das fand ich gut - als Zuschauer würde es mich interessieren, wenn Probleme aus unserem Alltag wie ein Thriller daherkommen.
Trailer Pre-Crime

- Eigentlich ist es doch toll, wenn man Verbrechen voraussehen kann – so könnten vielleicht zukünftige Terroranschläge verhindert werden. Was ist das Problem bei der Software?
Matthias Heeder: Es gibt Programme, die arbeiten nur auf Grundlage von Polizeidaten, also eingegangenen Notrufen, registrierten Verbrechen usw. und errechnet daraus nach dem Modell der Vorhersage von Erdbeben, wie sich Verbrechen um das so genannte Trigger-Delikt wellenförmig ausbreiten. In Deutschland gibt es mit Precobs eine vergleichbare Software, mit der die Polizei in Bayern arbeitet – um Einbruchsdelikte im Großraum München vorauszusagen. Wenn der Algorithmus jedoch sagt, dass ein bestimmtes Gebiet unter Alarm ist, hat die Polizei einen anderen Blick auf die Bevölkerung in diesem Gebiet. Das hört die Polizei natürlich nicht gerne, aber es ist so. Dann gibt es andere Programme, die sowohl mit personenbezogenen Daten als auch Polizeidaten arbeiten. Dies ist die Grundlage für die Heat List in Chicago. Bei diesem Verfahren bekommen die Leute Punkte. Unser Protagonist hatte beispielsweise 245 Punkte, bei 500 ist man höchstkriminell. Ich habe mal nachgefragt, wie man von der Liste wieder herunterkommt – die Antwort hieß nur: „Don't commit crime" - doch das ist lächerlich. Denn wenn die Polizei beispielweise weiß, dass Robert McDaniel auf der Heat List steht, wird sie öfter Kontakt mit ihm haben und ihn mehr kontrollieren als vorher. Jeder Kontakt wiederum wird protokolliert und geht direkt in sein Bewertungssystem – ein Teufelskreis. Diese Programme sind somit höchst problematisch.
Monika Hielscher: Es gibt auch Software-Lösungen, die ausschließlich mit Open Source-Daten arbeiten – also ganz bewusst nicht mit Polizei-Daten und personenbezogenen Daten. Da geht es um Sonnenaufgang, Regem, Verkehr, Busstationen und viele mehr – also alles, was man zu einem Datenpool verdichten kann, den ein Algorithmus auf bestimmte Fragestellungen hin untersucht. Diese Programme kommen zu ähnlichen Ergebnissen wie die anderen Software-Programme. Der große Unterschied ist, dass die Daten frei zugänglich sind und der Algorithmus veröffentlicht wird. Und das ist der entscheidende Punkt, denn alle anderen Software-Programme geben ihren Algorithmus nicht Preis. Erst wenn man diesen veröffentlicht und überprüfen kann, unterliegen sie einer demokratischen Kontrolle.
- Chicago, London, Paris, Berlin und München – warum wart ihr gerade in diesen Städten?
Matthias Heeder: Chicago liegt natürlich auf der Hand wegen der Heat List. In Paris haben wir gedreht, da unser französischer Soziologe aus dem Film dort beheimatet ist und wir die wunderbare Möglichkeit hatten, ihn während einer Demo am 1. Mai zu filmen. Was uns an dem Bild interessierte, war diese analoge politische Ausdrucksform durch jemanden, der uns erzählt, wie digitale Polizeiarbeit funktioniert. Ein Großteil des Films sollte im Dunkeln gehalten werden, weshalb die U-Bahn für uns ein idealer Ort war, um ihn im Film zu etablieren. In London gibt es schon seit mehreren Jahren eine Matrix genannte Datenbank, die dazu dient, Gangmitglieder zu identifizieren und somit präventiv tätig zu werden. Wir haben also geschaut, wer analog zu Robert McDaniel Opfer dieser Software ist, da von der Entwicklerfirma Accenture niemand mit uns reden wollte – so sind wir dann auf Smurf gestossen. Sowohl er als auch McDaniel sind hochintelligente junge Männer, beide wissen jedoch, dass sie in Zukunft kaum eine Chance haben werden.
Monika Hielscher: München wiederum war die erste Stadt in Deutschland, in der diese präventive Polizei-Software eingesetzt wurde. In Berlin war der Polizeikongress und wir hatten die Chance, mit ein paar Leuten zu sprechen. Hamburg ist übrigens gerade dabei, eine Software zu entwickeln.

- Ihr habt fast drei Jahre an Pre-Crime gearbeitet - was war für euch der schwierigste Part?
Monika Hielscher: Das schwierigste waren die Kontakte in Chicago, dort startet die Geschichte. Uns war immer klar, wenn wir Chicago erzählerisch nicht in den Griff bekommen, wird der Film nicht funktionieren. Wir brauchten also Zugang zur Polizeizentrale, Zugang zu Beamten und Zugang zu jemandem, der auf der Heat List steht. Das hat einfach sehr lange gedauert. Eine unserer Mitarbeiterinnen, die als selbständige Produzentin in den USA arbeitet, ist nach Chicago gefahren und hat den Journalisten ausfindig gemacht, der über Robert McDaniel geschrieben hat – und beide haben dann gemeinsam Robert McDaniel besucht und dazu gebracht, bei dem Projekt mitzumachen. Aber auch das hat sehr lange gedauert, da Robert immer wieder abgetaucht ist und nicht zu erreichen war. Auch mit Miles Wernick, dem Entwickler des Algorithmus, mit dem die Heatlist in Chicago arbeitet haben wir mehr als ein halbes Jahr hin und her geschrieben. Denn es war sehr schnell klar, dass er eigentlich nicht darüber reden möchte.
- Matthias, inwieweit hilft es dir bei der Arbeit als Dokumentarfilmer, dass du in den 80ern als Journalist gearbeitet hast?
Matthias Heeder: Wir drehen ja bis heute immer wieder Reportagen und Filme fürs Fernsehen - in ziemlich festgelegten Strukturen bzw. für bestimmte Slots. Das Problem dabei ist, dass dich das filmsprachlich überhaupt nicht weiter bringt. Man denkt bei diesen Fernsehproduktionen weniger in erzählerischen Strukturen, Stimmungen oder Ambivalenzen, sondern in Inhalten. Mit Pre-Crime ist ist es uns, auch Dank der wunderbaren Arbeit des Cutters Christoph Senn, gelungen, für dies sehr komplexe und abstrakte Thema eine filmsprachliche Lösung zu finden. Es dreht sich alles um Storytelling. Denn der Zuschauer möchte nicht belehrt werden, sondern verstehen und, wenn alles richtig gut läuft, auch unterhalten werden. Citizenfour ist ein Beispiel für sehr gutes Storytelling einer komplexen und abstrakten Situation.
- Macht ihr privat irgendetwas anders, seitdem ihr den Film gedreht habt?
Matthias Heeder: Ich bin schon vorher auf das Tor-Netzwerk ausgewichen. Facebook war eh nie relevant, nur für die Firma. Wir dunsten Daten aus wie Schweiß und die verschwinden irgendwo in der Cloud – und irgendjemand macht irgendetwas damit. Wie die Kontrolle hier hergestellt werden soll, ist mir ein Rätsel.
Monika Hielscher: Man sollte sich allerdings die Frage stellen: „Was ist mit uns als Gesellschaft geschehen, die wir in den 80ern massenhaft auf die Straße gegangen sind, um gegen die Volkszählung zu demonstrieren – und jetzt mit einer Selbstverständlichkeit intimste Dinge über uns veröffentlichen?"

- Ihr arbeitet jetzt seit über 30 Jahren zusammen – gibt es eine bestimmte Arbeitsteilung?
Matthias Heeder: Monika recherchiert die Projekte bis ins Detail – sie ist da viel fitter als ich. Ich schreibe dann die ersten Entwürfe auf Grundlage ihrer Recherche, die von Monika dann weiter bearbeitet werden. Dreharbeiten machen wir, soweit möglich und bezahlbar, zusammen. Im Schnitt wiederum sitzen wir zusammen, und der Film fängt langsam an zu leben. Ich liebe die Arbeit im Schneideraum. Filme entwickeln ab einem bestimmten Punkt ihr ganz eigenes Leben. Und dann diesen Weg zu gehen, hier abzuzweigen, dort zurückzukommen, das ist schon etwas anderes als die Storyline eines geschrieben Konzepts.
- Im Presseheft wird der Film als Weckruf bezeichnet – was hofft ihr, bleibt im Kopf der Zuschauer hängen, nachdem sie das Kino verlassen?
Monika Hielscher: Wir möchten die Leute natürlich nicht deprimiert hinausschicken. Es stimmt zwar, dass wir alle irgendwie in dieser Matrix gefangen sind, aber auf der anderen Seite spielt es auch keine Rolle. Man muss seine individuelle Freiheit trotzdem erhalten. Wenn Leute nach Terroristenangriffen sagen, „wir haben keine Angst, wir lassen uns nicht vertreiben", ist das quasi das gleiche Prinzip. Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen – und das soll auch hängen bleiben. Deshalb auch dieser Schluss Song: Reite den Tiger.
weitere Beiträge
.jpg?fit=max&w=800&h=1066&q=90&fm=webp)