
Ein Film auf 25 Quadratmetern
16.05.2018 | Im Gespräch mit Eibe Maleen Krebs

Ein starkes Kammerspiel, das beim Max-Ophüls-Preis 2018 die Auszeichnung der Jugendjury mit nach Hause nehmen konnte: Eibe Maleen Krebs' Regiedebut "Draussen in meinem Kopf" ist intensives Kino, das mit zwei tollen Nachwuchsdarstellern zu überzeugen weiß. Im Interview erzählt die Hamburger Filmemacherin, wie es ist, einen kompletten Kinofilm in nur einem einzigen Raum zu drehen – und was sie mit ihrem Film bewirken will.
- Dein Film Draussen in meinem Kopf spielt in einem Pflegeheim. Es geht um die Beziehung zwischen dem Pfleger Christoph und dem schwerkranken Sven, der an Muskeldystrophie leidet – außerdem greifst du das Thema Sterbehilfe auf. Warum hast du dich als Debutfilm gerade für diese Geschichte entschieden?
Ich habe die Idee zu diesem Film schon seit 15 oder 16 Jahren im Kopf gehabt. Nach meinem Fotografie- und Filmstudium kam bei mir die Frage auf, was als Debutfilm funktionieren könnte. Da lagen mehrere Filmideen auf der Wartebank, die eigentlich gerne behandelt werden wollten. Vom finanziellen Rahmen her war es jedoch am einfachsten, diesen Film zu drehen, der nur in einem Raum spielt und ein recht kleines Ensemble von Schauspielern hat. Ein Setting, das wir im Rahmen der Debutförderung mit dem "Kleinen Fernsehspiel" vom ZDF und der Wim-Wenders-Stiftung sehr gut umsetzen konnten. Ich kenne Wim seit dem Studium an der HFBK, er mochte meinen Abschlussfilm und wollte mich weiter unterstützen. Dann habe ich mich mit dem Drehbuch in seiner Stiftung beworben – und es hat geklappt. Ein super Anschub, um sich Freiräume beim Drehbuchschreiben zu erlauben. Ich hatte als Co-Autor Andreas Keck dabei. Dialoge zu zweit zu entwickeln ist spannend, weil man sich dann die Bälle zuwerfen kann.

- Beruht die Geschichte auf einer wahren Begebenheit?
Der Film ist inspiriert von einer wahren Begebenheit und dann frei entwickelt. Ich habe mit Zeitzeugen, Pflegern und Betreuern gesprochen. Ich wollte vor allem die Geschichte zwischen diesen zwei jungen Männern erzählen. Anfangs gibt es noch eine klassische Pfleger-Helfer Situation, aus der sich dann eine Freundschaft entwickelt, mit der sich parallel die moralischen Grenzen und auch das Schwarzweiß- Denken verschieben. Ich will gar nicht sagen, dass ich die Handlung von Christoph am Ende des Films richtig oder falsch finde. Ich will nicht beurteilen oder verurteilen. Ich möchte die Thematik der Sterbehilfe auf eine ungewöhnliche Weise beleuchten. Sowie die Frage, in wieweit junge Menschen emotional in pflegenden Berufen aufgefangen werden sollten.
- Das klingt so, als würdest du das System vom FSJ kritisieren
Ich finde super, dass es das gibt. Leute, die in der Pflege oder als Krankengymnasten arbeiten, kriegen jedoch immer die Sorgen und Ängste der Patienten mit. Sie sehen sie regelmäßig und sind Bezugspersonen. Und es ist nicht so einfach, die Grenze zwischen Arbeit und Privatleben zu ziehen. Bei einem Festival in Recklinghausen gab es zum Beispiel ein ganz tolles Publikumsgespräch. Im Publikum saßen auch Ärzte und Leute aus Pflegeberufen, die sehr viel zu dem Thema zu sagen hatten. Sie waren dankbar dafür, dass es mal einen Film gibt, der diese Problematik so zeigt.
Trailer - Draussen in meinem Kopf

- Der Film spielte fast komplett in nur einem kleinen Raum. Was waren die besonderen Herausforderungen?
Wir haben in einem Studio gedreht. Der Raum wurde gebaut und war etwa 25 Quadratmeter groß. Es war eine Herausforderung, das Zimmer immer wieder neu zu erzählen. Das Bett im Film hat unterschiedliche Positionen und es gab ein ausgeklügeltes Lichtkonzept. Es macht zum Beispiel einen großen Unterschied, ob die Gardinen auf oder zu sind, ob es sonnig oder bewölkt ist, alles unterstützt die Geschichte subtil. Auch die Kameraeinstellung hat eine große Wirkung. Wenn Sven alleine im Raum ist, dann ist die Kamera distanziert und starr, was seine Lebenssituation gut veranschaulicht. Sobald ihn jemand besuchen kommt, geht die Kamera dicht ran und wird beweglich. Die Unbeweglichkeit scheint sich förmlich aufzuheben, wenn Sven in Interaktion steht. Wir hatten ein komplexes Bild-Konzept für den Film entwickelt. Viele Menschen haben mir gesagt, dass der Film sehr kurzweilig auf sie gewirkt hat und sie gar nicht darüber nachgedacht haben, dass alles in nur einem Raum spielt.

- Es ist wirklich toll, den beiden Hauptdarstellern bei ihrem Schauspiel zuzuschauen. Wie waren die Dreharbeiten?
Wir hatten das Glück, dass wir vor den Dreharbeiten eine Woche lang proben konnten. Dann waren vier Wochen Pause bis Drehbeginn – in dieser Zeit habe ich noch Kleinigkeiten im Drehbuch verändert. Samuel und Nils haben ihre Rolle während der Pause sacken lassen und auch immer das Gespräch mit mir gesucht – und sich auch untereinander getroffen. Als wir dann angefangen haben zu drehen, lief es einfach. Wir mussten somit nicht bei null anfangen. Da der Film in einem Studio gedreht wurde und unsere Bildgestalterin Judith Kaufmann und ich im Vorfeld das Kamera und Lichtkonzept besprochen hatten, konnten wir sehr viel Zeit auf das Drehen verwenden.
Nils war zu der Zeit 21 Jahre alt und noch mitten in der Schauspielschule. Er war super vorbereitet, jeden Tag konzentriert und voller Energie. Auch mit Samuel war es toll – und witzig. Wenn wir Umbauten hatten, blieb er meistens einfach im Bett und machte Späße mit den Beleuchtern und Bühnenmännern. Es war eine gute Stimmung am Set.
- Man hat bei Samuel Koch immer seinen „Wetten, dass.."-Unfall im Kopf – gerade wenn er dann eine Rolle spielt, bei der er ans Bett gefesselt ist.
Ja, das ist immer noch ein riesen Thema. Aber viele Kinozuschauer haben mir erzählt, dass sie es nach wenigen Minuten komplett vergessen hätten. Ich meine, er ist ein Schauspieler. Und er spielt eine Rolle, genauso wie alle anderen Schauspieler auch. Natürlich hat er diese Geschichte – aber es ging uns darum, die Geschichten zwischen Sven und Christoph zu erzählen. Und da müssen auch alle anderen Schauspieler ihre eigene persönliche Geschichte hinten anstellen und ihre Rollen spielen. Und ich finde, dass sie das wirklich gut gemacht haben.

- Hätte das auch mit einer anderen Besetzung funktioniert?
Ich denke schon. Dass unser Cast jedoch außergewöhnlich ist, haben wir schon im Casting gesehen. Es gibt natürlich auch Dinge, die sich ein Schauspieler ohne Behinderung antrainieren kann – zum Beispiel die besondere Art und Weise zu atmen und die Lungen nicht ganz voll zu kriegen, so dass Pausen entstehen beim Sprechen. Aber das Physische, was Samuel auf natürliche Weise mitbringt, das unterstreicht die Rolle. Ich habe recht lange drüber nachgedacht, mit einem Schauspieler zu drehen, der sich ganz normal bewegen kann. Mario Fuchs, der im Film den Laus spielt, ist ein ganz normaler Schauspieler und spielt jemanden mit einem Spasmus – er hat sich das wirklich toll angeeignet. Mario hat sich mehrere Tage mit einem Menschen mit einem Spasmus getroffen und ihn begleitet. Er hat einfach geguckt, wie er redet, sich bewegt, lacht, all das.
- Samuel Koch stehen im Film eigentlich nur seine Mimik zu Verfügung, um Emotionen rüberzubringen. Hat das immer gleich direkt geklappt?
Wir haben manchmal viele Takes gedreht und manchmal hat es ganz schnell funktioniert. Das hat auch was mit Tagesform zu tun, würde ich sagen. Er bringt jedoch tolle Augen, ein schönes Gesicht und eine wunderbare Stimme mit. Das war auch ein Faktor beim Casting. Ich dachte nur: Wow, super Stimme. Und auch diese Nuancen mit den Augen. Er hat ein sehr feines Spiel. Aber das hat auch was mit der Art und Weise zu tun, wie gefilmt wird. Ich wollte unbedingt jemanden an der Kamera haben, der an die Menschen herankommt.
- Gibt es da irgendwelche Tricks oder Techniken?
Es gibt Menschen die es schaffen, die Darsteller vor der Kamera zu knacken. Dafür braucht man Gespür und Sensibilität – und Vertrauen ist ebenso wichtig. Jeder Schauspieler ist anders, ich glaube, dass es keine eindeutige Technik gibt. Vielleicht braucht man vor allem Liebe zum Film. Außerdem muss der Bildausschnitt richtig gewählt werden – das war auch für Draussen in meinem Kopf sehr wichtig, da wir die Charaktere intim und verletzlich zeigen. Es gibt Kameraleute, die technisch perfekte Bilder machen, die dann aber seelenlos sind. Und dann gibt es Menschen wie Judith Kaufmann, die wirklich die Seele einfangen können.
- Wie bist du auf Verena Gräfe-Höft von Junafilm als Produzentin gekommen?
Ich hab sie nachts um vier Uhr bei der Tore Tanzt-Premiere beim Filmfest Hamburg angesprochen, wo sie natürlich eigentlich ganz andere Dinge im Kopf hatte. Und dann haben wir uns immer mal wieder getroffen. Ich war zu der Zeit auch mit anderen Produzenten im Gespräch, doch irgendwann meinte Verena: „Schick mir doch mal das Buch" – und dann ging alles ganz schnell. Ich war super glücklich, weil ich sie von Anfang an für das Projekt haben wollte. Unsere Zusammenarbeit war super und ich finde es wichtig, dass sie auch dem Nachwuchs eine Chance gibt. Wie zum Beispiel auch Marianne von Deutsch, die als Editorin ebenfalls ihren ersten langen Kinofilm mit Draussen in meinem Kopf geschnitten hat. Es ist wichtig, diese Möglichkeiten zu bekommen. Für Verena und mich war es bestimmt nicht der letzte gemeinsame Film.

- Du bist ja auch beim Festival "Klappe Auf" aktiv, das sich für inklusives Kino einsetzt. Jetzt mit Blick auf deinen neuen Film: Wie ist der Stand der Barrierefreiheit in den deutschen Kinos? Was muss noch getan werden?
Natürlich kann mehr getan werden – wir können davon ein Lied singen. Das kostet wahnsinnig viel Geld: von der Audiodeskription der Untertitel über Gebärdendolmetscher bis hin zu Schriftdolmetschern und barrierefreien Eingängen für Rollstuhlfahrer. Viele Kinos sind historische Gebäude und haben gar nicht die Möglichkeit, von heute auf morgen umzurüsten. Es ist einfach wichtig, Sichtbarkeit für diese Thematik zu bekommen, so dass Barrierefreiheit zu einer Selbstverständlichkeit wird.
weitere Beiträge

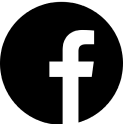

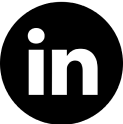


.jpg?fit=max&w=800&h=1066&q=90&fm=webp)
