
Female Misbehaviour!
22.04.2018 | Monika Treut

Seit über 30 Jahren prägt die lesbische Regisseurin, Autorin und Produzentin Monika Treut mit ihren lustvoll-subversiven Spiel- und Dokumentarfilmen das queere Kino in Deutschland und der ganzen Welt. Nun erscheinen die Schlüsselfilme der Hamburger Regisseurin neu auf DVD in der Box "Female Misbehaviour!". Zeit für ein Interview!
- Deinen allerersten Film, mit Elfi Mikesch zusammen gedreht, hast du 1985 auf der Berlinale uraufgeführt.
Ja, Verführung: Die grausame Frau, den hatte man im Rohschnitt für interessant befunden und eingeladen, dann sind wir kurz vor der Premiere mit der noch feuchten Filmkopie im Delphi-Kino aufgeschlagen. Die Berlinale war noch überschaubar, es gab nur den Wettbewerb und das Forum, da hatte auch ein Forumsfilm noch eine ganz andere Aufmerksamkeit als heute. Was bei uns hieß: Es gab einen regelrechten Skandal. Das Delphi-Kino war voll, und nach dem Film fing sofort eine Beschimpfung an, richtig aggressiv, vor allem von Männern. Die Leute, die den Film mochten, haben nichts gesagt.
- Es wurde von niemandem außer euch verteidigt?
Nein, zero. Nur hinterher gab es eine schöne Kritik in der FAZ, ausgerechnet. Aber nach der Berlinale wurden wir zu vielen internationalen Festivals eingeladen, von Edinburgh bis New York, nicht nur zu den schwullesbischen.

- Wie erklärst du dir die spezifisch deutsche Ablehnung?
Ich denke, wir haben ein Frauenbild gezeigt, das bis dahin im deutschen Film noch unbekannt war. Es gab zwar schwule Filme, zum Beispiel von Fassbinder, der ja auch aggressiv an Tabuthemen rangegangen war. Aber es gab bis dahin kaum Filme, in denen Frauen selbstbewusst aufgetreten sind, kaum Frauenfiguren, die eine Form von dominanter weiblicher Sexualität gezeigt haben. Das war neu. Da war die westdeutsche Gesellschaft doch noch recht konservativ. Damals wurde der Feminismus vor allem von Alice Schwarzer vertreten, die im Grunde kein Konzept von selbstbestimmter weiblicher Sexualität hatte. Ihre Arbeit bezog sich auf Vergewaltigung, Zwangs-Prostitution und die PorNo-Kampagne. Wir zeigten in Verführung: Die grausame Frau eine Domina, die selbstbewusst ihre eigenen sexuellen Phantasien umsetzte, das war 1985 wohl zu früh. Die Männer haben das kritisiert, die Frauen haben nichts gesagt.
- Studiert hast du in Marburg ...
Ja, Literatur- und Kunstwissenschaften. Es gab damals noch keinen Magister, man ist automatisch auf ein Staatsexamen zugelaufen, das wollte ich gar nicht. Ich musste auch ein Schulpraktikum machen und drehte mit den Kids einen Western im Wald. Dass die Schülerinnen und Schüler nachmittags und außerhalb des Schulgeländes nicht versichert waren, war mir egal, also gab es handfesten Ärger mit der Schulleitung. Damit war klar, dass ich nicht in einer regelhaften Institution arbeiten konnte. Nach dem Studium habe ich ein Doktorandenstipendium bekommen und habe parallel in Berlin und Hamburg in Medienzentren gearbeitet.
- Du bist Frau Doktor Treut, oder?
Ja, auch das noch. Wenigstens ein Studienabschluss.
- Und deine Berührung mit Film?
Mein frühes Interesse kam durch meinen Vater. Seitdem ich ungefähr vier Jahre alt war, nahm er mich in Mönchengladbach jeden Samstag mit ins Kino. Eine ziemlich konservative Stadt, damals eine Hochburg der CDU in NRW. Mit sechzehn habe ich dann im Programmkino Polanskis Repulsion (dt. „Ekel", 1965) gesehen, der hat mich ungeheuer beeindruckt. Ich hatte aber nie vor, selbst Filmemacherin zu werden, das war völlig außerhalb meiner Vorstellung. Später in Marburg hatten wir Literaturwissenschaftsstudenten das Gefühl, dass wir visuelle Analphabeten waren. Deshalb haben wir angefangen, Filme ins Studium zu integrieren. Wir besuchten Seminare von Alexander Kluge in Frankfurt, drehten mit Erstsemestern Super8-Filme. Und gleichzeitig bauten wir ein Kommunikationszentrum auf, in dem wir Filmreihen zeigten, auch seltene Filme, wie z.B Vent d'Est (dt. „Ostwind", 1970) von Godard aus seiner maoistischen Phase. Den gab es damals weltweit nur in zwei Kopien, ohne Untertitel oder Dialoglisten.

Wir haben ihn mit französischen Freunden in der Nacht vor der Vorführung in meiner WG an die Wand projiziert, die deutsche Übersetzung gemacht und am nächsten Tag eingesprochen.
- Wie funktionierten Medienzentren damals?
Das war eine Bewegung in den 1970ern, die hatte sich mit den ersten erschwinglichen Sony-Videogeräten entwickelt, Halbzoll, schwarzweiß, sehr primitiv. Man machte Reportagen über Ereignisse, die nicht in den Mainstream-Medien vorkamen und zeigte sie in Kneipen und an alternativen Orten.
- „Gegenöffentlichkeit" ...
Genau, und dann hat man auch Kurse gegeben und das Wissen weiter vermittelt. Die Bewegung kam ursprünglich aus England und hat sich in Deutschland vor allem in Hamburg, Frankfurt und Berlin konkretisiert. Ich arbeitete zuerst in einem Medienzentrum in Berlin, da hat es mir nicht so gut gefallen, weil es ein reiner Männerladen war. In Hamburg gab es damals einen Medienladen, aus dem sich eine Frauengruppe entwickelt hatte. Der habe ich mich dann angeschlossen und wir gründeten 1979 das feministische Medienzentrum „Bildwechsel", das noch heute existiert.
- Gab es ein Bedürfnis, auch Filme über lesbisches Begehren zu sehen, zu programmieren?
In den 1970er Jahren gab es ja nur wenige lesbische Filme. Wir haben eigene Videos produziert, z.B. habe ich damals ein Video über eine befreundete lesbische Punkgruppe, „Bitch-Band No1", gedreht. Dazu haben wir einmal die Woche Frauenkino veranstaltet und Regisseurinnen dazu eingeladen, u.a. Ulrike Rosenbach und Ulrike Ottinger. Und Elfi Mikesch natürlich.

- Du hast mit Elfi Hyena Films gegründet, als niemand „Verführung" produzieren wollte. Es gab eine Förderzusage, die wieder zurückgezogen wurde ...
Ja , vom Bundesinnenminister. Sowas kann man sich heute nicht mehr vorstellen, dass die Filmförderung einmal im Bundesinnenministerium angesiedelt war – der Herr Zimmermann hat sich also damals gleichzeitig um die Polizei, die innere Sicherheit und die Filmkultur gekümmert ... Er war ein Rechtsaußen, CSU-Mann, klar, dass ihm unser Drehbuch nicht gefallen hat. Es kam keine direkte Ablehnung, es fiel auf bürokratische Weise durch. Es gab ein unabhängiges Gremium, das sich für eine Förderung ausgesprochen hatte, wir bekamen aber dann Nachfragen aus dem Ministerium: „Wie wollen Sie die Szene ,Ich möchte Ihre Toilette sein' denn umsetzen?" Es war klar, wenn wir das beantworten, kommt in anderthalb Jahren vielleicht mal ein Ja oder ein Nein. Und so haben wir mit dem Geld der Länderförderung gearbeitet – ein Politikum, weil die SPD-geführten Länder das ein Unding fanden, dass so ein rechter CSU-Minister über die Filmförderung entscheidet.
- Mit deinem zweiten Film, „Die Jungfrauenmaschine" (1988), lief es in Deutschland ähnlich problematisch, und wieder kam er im Ausland super an. Da hat es dir dann hier gereicht, oder?..
Ja, der Film hatte in den USA den Zeitgeist getroffen, da gab es ja schon einen kleinen Boom von Filmen über Frauen, auch über Lesben, die Filme von Lizzie Borden zum Beispiel, Born in Flames (1983) und Working Girls (1986). Nicht zu vergessen Donna Deitchs Desert Hearts (1985). Da hat man sich über die „Jungfrauenmaschine" nicht so erschrocken wie hier in Hof. „Oh, ein interessanter Film aus Deutschland, lustig ist er auch, und da geht es um Lesben, das ist frisch, her damit!" Er lief auf dem Filmfestival in Toronto als Eröffnungsfilm des internationalen Programms, es waren mehrere US-Verleiher interessiert, ich konnte mir einen aussuchen. In Deutschland ist der Verleih nach schlechter Premieren-Presse abgesprungen. Ich habe versucht, den Film selbst zu verleihen, da hieß es: „Was, dieser schreckliche Film aus Hof? Auf keinen Fall!" So bin ich dann nach New York geflohen.
- Es gibt dieses berühmte Zitat aus der „Zeit"-Besprechung der „Jungfrauenmaschine": „Filme wie dieser vernichten das Kino!"
Tja, das hing wohl damit zusammen, dass der deutsche Film damals im Ausland nicht so beliebt war. Man überlegte sich, was ja zyklisch ist, wie der deutsche Film international Fuß fassen kann. Heinz Badewitz, der damalige Leiter der Hofer Filmtage, hatte die Jungfrauenmaschine, die er sehr mochte, auf den prominentesten Termin gesetzt. Ich hatte Bedenken und dachte: lieber eine Spätvorstellung! Es war ein Desaster. Es waren überwiegend Kinobesitzer dort, und was sie sahen, wollten sie nicht wahr haben: Schwarzweiß, 16mm, experimentelle Bilder, der dicke Peter Kern und dann noch eine Lesbengeschichte! So kann aus dem deutschen Film nichts werden! Dann hat Manfred Salzgeber den Film übernommen, ein Jahr lang im Kant-Kino gezeigt und nach einem Jahr sah es besser aus.
- Einfach mal eine lesbische Liebesgeschichte zu erzählen, darauf hattest du eher keine Lust oder?
Eher nicht. Da gibt's ja auch massenhaft Material.
- Damals vielleicht noch nicht ...?
Damals noch nicht so, das stimmt. Aber so normale Geschichten haben mich nie interessiert. Vielleicht war das auch der Reibungspunkt mit dem lesbischen Publikum, die waren hungrig danach. Und das haben die mir übel genommen, „warum erzählst du denn nicht mal eine schöne Liebesgeschichte?"
- Ja, warum denn nicht ...?
Ich fand das langweilig. Ich war eher mit experimentellen Filmen vertraut, es gab so viele spannende Themen. Später gab es ja eine Lawine von Filmen über lesbische Beziehungen, die waren ja schön gemacht, aber ich habe auf so ein Genre nicht hingearbeitet. Das Lesbischsein war in dem Sinne für mich nie ein Problem, das musste ich nie im Film darstellen. Es war für mich irgendwie kein Thema.
- Wie würdest du in ein paar Sätzen deine Zeit in New York beschreiben?
Ich hab da noch die spannende Zeit miterlebt, bevor Bürgermeister Giuliani die 42nd Street zu Disneyland gemacht hat. Das war damals noch total friedlich, eine Mischung aus Künstlern, Bohème, Lesben, Schwulen, Heteros, tatsächlich ein Melting Pot von queerem künstlerischen Leben. Anfang der 1990er hat sich das sehr schnell verändert, die ärmeren KünstlerInnen sind immer weiter verdrängt worden. Ich fahre nur noch selten hin, meine Freundinnen leben fast alle nicht mehr dort
- Wie hast du denn in den USA arbeiten können?
Ich habe in der Zeit My Father Is Coming (1991) und zwei Teile von Female Misbehavior (1992) gemacht – unterstützt von der Hamburger Filmförderung. Das funktionierte damals, weil ich die Postproduktion der Filme z.T. in Hamburg gemacht habe. Außerdem hatte ich ja als Produzentin die Rechte an den Filmen, und ich bekam noch Garantien für die Filmrechte von Festivals und Verleihern, auch von Auslands-TV-Verkäufen. Alles andere hat sich in der vielfältigen Indie-Szene der Stadt überwiegend sehr unproblematisch ergeben. Über meinen amerikanischen Verleih, First Run Features, hatte ich ein internationales Künstlervisum bekommen, mit dem ich unproblematisch ein- und ausreisen konnte und einen legalen Status in den USA hatte. Sowas gibt es leider nach 9/11 nicht mehr.

- Warum bist du dann wieder nach Deutschland gegangen, als es mit dem New Queer Cinema in den USA gerade spannend wurde?
Naja, für mich war das „New Queer Cinema" der USA nicht so spannend. Dagegen: Deutschland veränderte sich, die Mauer war gefallen. Ich war neugierig. Auf der Berlinale 1990 sprachen mich etliche Filmarbeiterinnen aus dem Osten an und wollten mich in New York besuchen. Da war ich plötzlich Miss Popular. Und in New York schliefen sie auf meiner Luftmatratze und knüpften von da aus weiter Kontakte. Ich war also eine Zeit lang eine Anlaufstelle für ostdeutsche FilmemacherInnen. Sie wollten mit Macht in den Westen, diese Energie fand ich beeindruckend.
- Hast du in deiner Karriere mal richtig Gegenwind erlebt, strukturelle Diskriminierungen oder Zensur?
Ich habe mal in Roanoke, Virginia, an einem College unterrichtet. Da gab es in der lokalen Presse einen Artikel mit Foto, ich auf dem Collegegelände mit Sonnenbrille, Zigarette und Jeansjacke, dazu der Text: „Monika Treut peoples her movies with homosexuals, prostitutes, transsexuals" usw. Das war ein „All Girls Liberal Arts College", da gab es dann Protest-anrufe, Eltern wollten ihre Töchter von der Schule nehmen, ich sollte wieder nach Deutschland abhauen. Und zusätzlich gab es eine Demo – Leute mit Schildern wie „Lesbianism is not normal". Das beste war: „It's not right to do what's wrong." Das fand ich richtig, da habe ich mich daneben gestellt. Hinter der Demo steckte die lokale evangelikale Kirche, sie haben für mein Seelenheil gebetet, aber sie wollten auch die Vorführung meiner Filme verhindern. Ich bekam dann Polizeischutz auf dem Campus.
- Und in Deutschland?
Unser Film „Verführung" landete absurderweise für 18 Jahre auf dem Index für jugendgefährdende Medien. Da war er in guter Gesellschaft. Leider scheiterte daran ein Fernsehverkauf. Das Geld hätten Elfi und ich damals dringend gebraucht. Was ich auch immer merkwürdig fand: Ich habe noch nie Geld von der Filmförderungsanstalt bekommen. Den Grund bekam ich irgendwann mal schriftlich, so ungefähr: „Was wollen Sie denn, sie machen doch nur Festivalfilme, sie brauchen gar nicht erst einzureichen." Da ist ein Ungleichgewicht, wenn man sich ansieht, wie viele Filme da gefördert wurden, die nur einmal auf einem Festival liefen und spät nachts versendet wurden. Insgesamt habe ich extrem viele Ablehnungen kassiert von allen möglichen Förderquellen. Ich habe dann meistens die Filme trotzdem mit weniger Geld realisiert, und es ist ja mittlerweile auch statistisch nachgewiesen, dass Regisseurinnen in der männerdominierten Filmwelt mit viel kleineren Budgets operieren müssen.
- Was begeistert dich aktuell in der Branche?
Die Pro-Quote-Regie-Bewegung. Da bin ich ja eine der älteren, da sind tolle, jüngere Filmemacherinnen dabei. Etliche Talente, die ich ganz spannend finde.
- Und wie geht's jetzt bei dir weiter?
Ich mache jetzt Gendernauts Revisited, zwanzig Jahre später. Die ProtagonistInnen von Gendernauts (1999) leben alle noch, sie waren die Pioniere der Trans-Bewegung. Sie leben aber fast alle nicht mehr in San Francisco, das können sich die meisten nicht mehr leisten. Es ist schon erstaunlich, wieviel sich in den letzten zwanzig Jahren verändert hat.
Das Interview hat Jan Künemund anlässlich der Verleihung des Special Teddy Awards an Monika Treut im Februar 2017 geführt. Es handelt sich bei dem hier hochgeladenen Interview lediglich um eine gekürzte Version – das ganze Interview gibt es auf: http://www.sissymag.de/monika-treut-female-misbehavior/
weitere Beiträge

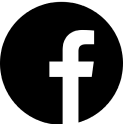

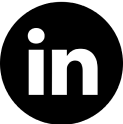
.jpg?fit=max&w=800&h=1080&q=90&fm=webp)

