Ein Film wie ein Pilzgeflecht
06.02.2019 | Berlinale 19
In "Olanda" begleitet der Hamburger Regisseur Bernd Schoch in Rumänien Pilzsammler bei der Arbeit, die über Monate in provisorischen Zeltlagern entlang der Transalpina leben. Der Dokumentarfilmer zeigt dem Zuschauer dabei sowohl die magische Welt der Karpaten als auch die komplexen wirtschaftlichen Strukturen hinter dem Pilzhandel. Im Rahmen der Berlinale feiert der Film seine Weltpremiere.
- Wie bist du zu dem Thema gekommen?
Im Jahr 2012 bin ich auf einer Reise mit meiner Familie die Transalpina über die Karpaten entlanggefahren. Wenn man aus dem Norden von Sibiu kommt, sieht man lange Zeit nichts als Wälder. Dann sind wir quasi aus dem nichts auf ein riesiges Markgeschehen gestoßen. Überall lagen zentnerweise Steinpilze und Beeren herum und wurden verladen. Wir haben kurz angehalten und uns das rege Treiben angeschaut. Mit dem zweiten Blick hat sich das scheinbar romantisch anmutende Zeltlager am Rande dieses Marktgeschehens dann in seiner ökonomischen Notwendigkeit offenbart. Dieses Bild hat sich bei mir eingebrannt. Im Jahr 2014 bin ich dann nochmal hingefahren, um zu schauen, ob ich diesen Platz wieder finde und das Erinnerte auch tatsächlich so stattgefunden hat – und das war der Startschuss für den Film.

- Wie oft seid ihr nach Rumänien gefahren und wie schnell habt ihr eure Protagonisten gefunden?
Wir haben 2016 bei der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein Projektförderung beantragt und sind mit diesem Geld für einen Recherchedreh für drei Wochen hingefahren. Es ging uns darum, einen Zugang und mögliche Protagonisten zu finden. Wir hatten auch eine Kamera dabei um Testaufnahmen zu machen – für den tatsächlichen Filmdreh ein Jahr später war das sehr hilfreich, da sich die meisten Leute im Tal an uns erinnerten. Wir blieben die ganze Pilzsaison von Juli bis Oktober – die Menschen vor Ort hatten also die Möglichkeit uns besser kennenzulernen.
Der Dreh war physisch teilweise sehr anstrengend. Das Wetter und die landschaftlichen Gegebenheiten waren immer wieder eine Herausforderung. Wir mussten teilweise nachts um 4 Uhr hinten auf einem Pickup zwei Stunden im Regen durch schwieriges Terrain fahren, um dann den Sammlern mit Kamera und Tonequipment für Stunden durch die Bergwälder zu folgen. Für die Pilzsammler war das alles Alltag. 15-20 Kilometer mit zehn Kilo Steinpilzen auf dem Rücken. Auf und Ab.

- Hast du selbst in den Zeltlagern gelebt?
Wir haben eine Pension im Tal genommen, da wir ja die ganze Technik irgendwo unterbringen mussten und natürlich auch Strom brauchten. Bei einem der Lager haben wir dann jedoch auch gezeltet. Das war ein Camp in der Talsohle am Fluss Lotru. Eines morgens sind wir nach einer regnerischen Nacht erwacht und der Fluss hatte das ganze Lager überschwemmt. Dieser Moment ist jetzt auch im fertigen Film zu sehen.
- Was ist dir am stärksten in Erinnerung geblieben von den Dreharbeiten?
Mitten in der Nacht aufstehen, um der erste an den Pilzspots zu sein und das erste Licht zu nutzen. Außerdem gab es trotz des Wettbewerbs, des rauen Umgangstons und der prekären Bedingungen doch auch so etwas wie einen fürsorglichen solidarischen Umgang untereinander.
- Warum bist du nicht in die Länder gereist, in denen die Pilze verkauft werden?
Eigentlich hatten wir das tatsächlich vor – und zwar hier in Hamburg. Ein schöner Platz für eine Einstellung wäre beispielsweise die Strandperle mit den großen Frachtern im Hintergrund gewesen, der eine weitere Ebene kapitalistischer Handelsströme sichtbar gemacht hätte. Doch dann haben wir während des Drehs gemerkt, dass wir das gar nicht brauchen. Das westliche Ausland war in den Zeltlagern der Pilzsammler die ganze Zeit präsent. Ob die Hamburg-Taschen des Zwischenhändlers vor Ort, das Husumer Krabben-Auto oder die Deutschland Mütze eines Sammlers. Man konnte sich dem quasi gar nicht entziehen. Es ist ja so, dass die Erste-Klasse-Pilze nach Deutschland kommen und die Second Hand-Kleidung nach Rumänien wandert. In zwei Jahren wird man in Rumänien die ganzen hier unerwünschten Dieselautos auf den Straßen fahren sehen.


- Kann man sagen, dass der Film auch ein wenig wie ein komplexes Pilzgeflecht aufgebaut ist?
Es war von Anfang an klar, dass wir den Pilz als narratives Modell für den Film verwenden wollen. Seit längerer Zeit schon interessiere ich mich für den Pilz als komplexes Lebewesen, das zwischen Tier und Pflanze ein eigenes Reich bildet. Nur ein kleiner sichtbarer Teil befindet sich an der Oberfläche, doch das große Geflecht, Mycel genannt, befindet sich unter der Erde und ist fürs Auge unsichtbar. Das es im Film nun so viele Nachtbilder gibt, hat ebenso wie die Verwendung eines Offtextes mit der Visualität des Pilzes zu tun. Außerdem folgt die filmische Erzählung nicht nur einem Handlungsstrang, sondern entwickelt vielmehr unterschiedliche episodische Handlungsverläufe, die sich im Verlauf des Films immer wieder überschneiden und damit auch das Mycel anspielen.
- Was für ein Gefühl war es als du erfahren hast, dass dein Film bei der Berlinale läuft?
Es war ein klasse Gefühl. Für mich war es das erste Mal, dass am Ende alles so aufgegangen ist, wie ich es mir erhofft hatte. Und das Forum ist auf der Berlinale auch der Ort, an dem ich mich mit meinem Film am wohlsten fühle.
- Hatte deine Arbeit an der HFBK in Hamburg irgendeinen Einfluss auf Olanda?
Es haben viele meiner HFBK-Kontakte am Film mitgewirkt. Angefangen bei einem meiner Produzenten, Karsten Krause, den ich dort kennen gelernt habe, bis hin zu André Siegers (Co-Autor) Tim Liebe (Postproduktion) und Steffen Goldkamp (Plakatgestaltung). Es war toll, mit all diesen großartigen Menschen zusammenzuarbeiten.

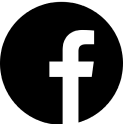

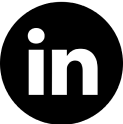

.jpg?fit=max&w=800&h=1080&q=90&fm=webp)
