
„Hark Bohms Kindheitserinnerungen sind bis heute aktuell“
13.05.2025 | Fatih Akins „Amrum“ in Cannes
-2025-bombero-international-gmbh-&-co.-kg_rialto-film-gmbh_warner-bros.-entertainment-gmbh_mathias-bothor.jpg?fit=max&w=1280&h=1773&q=85&fm=webp)
Der Hamburger Filmemacher Fatih Akin ist so etwas wie ein Dauergast beim Filmfest in Cannes. Er saß schon in der Jury und 2017 konkurrierte „Aus dem Nichts“ um die Goldene Palme. Nun wird „Amrum“ über die Kindheitserinnerung von Hark Bohm bei dem Festival Weltpremiere feiern. Im Interview erzählt Fatih Akin, warum der Stoff so aktuell ist, er Amrum für eine gesunde Insel hält und dass er den Film eigentlich gar nicht drehen wollte.
Filme über Hunger haben etwas Existenzielles.
Interview: Britta Schmeis
- Was bedeutet es dir, dass „Amrum“ nun in Cannes seine Weltpremiere feiert?
Fathi Akin: Das habe ich nicht erwartet. Das ist ein großes Geschenk. Man weiß ja nie, auf welche Resonanz so ein Film stößt. Das richtig einzuschätzen, habe ich in 30 Jahre Filmemachen nicht gelernt.
- Und wie kam dann „Amrum“ nach Cannes?
Fathi Akin: Nachdem meine Frau Monique den Film gesehen hatte, als er fast fertig war, hat sie gesagt, dass ich ihn unbedingt dem Cannes Auswahl-Gremium zeigen muss. Sie glaubte, dass er ihnen gefallen würde. Und sie hatte wohl Recht.
Amrum Trailer

- Was hat denn dem Gremium daran gefallen?
Fathi Akin: Ich glaube, die Geschichte, die hinter dem Film steckt. Ursprünglich sollte Hark Bohm ihn ja machen. Das konnte er dann aus gesundheitlichen Gründen nicht. Hark ist mein Filmlehrer, mein Lehrer fürs Leben und mein Freund. Ich glaube, das rührt an. Sie hat aber auch der Stoff interessiert. Der Film spielt in Deutschland im Jahre Null, unmittelbar nach dem Krieg und fragt, wie weit der Nationalsozialismus in eine Familie reicht, wie weit eine Familie geht mit ihrer Ideologie. Was ihnen nun kinematografisch gefallen hat, das musst du sie selber fragen.
- Wie ist es denn überhaupt zu dem Film gekommen?
Fatih Akin: Wie gesagt, Hark wollte ihn eigentlich drehen. Ich hatte ihn dazu animiert, nachdem er mir seine Kindheitsgeschichte erzählt hatte. Wir haben zusammen an dem Drehbuch gearbeitet. Dann stieg er aus und fragte mich, ob ich den Film nicht drehen wollte. Ich hatte erst meine Zweifel, aber weil es Hark ist und weil er mein Freund ist und weil er um die Ecke wohnt, habe ich es doch gemacht. Eine erste Drehbuchfassung hatte Hark einem befreundeten Verleger zum Lesen gegeben und der hatte gesagt, dass daraus ein Roman entstehen muss. Der ist dann erschienen, als wir mit unseren Dreharbeiten begannen. Das Filmprojekt war also erst da. Ich hatte den Roman aber weder vor noch während der Dreharbeiten gelesen. Das hätte mich zu sehr verwirrt. Ich wollte meine eigene Interpretation der Geschichte.

- Der Film, ebenso wie der Roman, erzählt von dem 12-jährigen Nanning, Hark Bohms Alter Ego, der im Zwiespalt zwischen seinen Nazi-Eltern und Nazi-Gegnern die letzten Tage des Zweiten Weltkrieges auf Amrum erlebt. Der auch die Familie ernähren muss und dafür unter anderem auf Robbenjagd geht. Wie lautet deine Interpretation des Stoffes?
Fatih Akin: Es sind viele Themen. Erst einmal: Man kann sich die Eltern nicht aussuchen. Und Eltern können sich ihre Kinder nicht aussuchen. Was bedeutet das, wenn du politisch irgendwo stehst und deine Eltern ganz woanders? Das ist ja etwas, was man heute überall antrifft, dass innerhalb von Familien nicht mehr über Politik geredet werden kann, weil die Positionen so gegensätzlich sind. Wie ist dann der Umgang mit dem inneren Feind, der die eigene Mutter oder der eigene Vater ist? Das hat mich sehr interessiert.
Und dann hat mich die Frage nach der Konsumgesellschaft heute und der Hunger, der damals herrschte, interessiert. Hunger und Verzicht, das kennen wir nicht mehr. Aber man muss sich nur in der Welt umschauen, da herrscht noch ganz viel Hunger. Hunger ist ein Begleiter der Menschheit, ein entscheidender Faktor in der Evolution. Hunger gibt es nicht mehr in der westlichen Welt, aber vielleicht kommt er ja wieder, vielleicht nach einem Blackout, durch Krieg oder wenn wieder ein Virus auftaucht. Filme über Hunger haben etwas Existenzielles.
linda-rosa-saal_web.jpg?fit=max&w=1000&h=4128&q=85&fm=webp)
- Der Film spielt auf Amrum. Dort habt ihr auch die meiste Zeit gedreht. Kanntest du die Insel?
Ich kannte Amrum nicht. Und nun hat die Insel tatsächlich mein Leben bereichert, weil sie wunderschön und sehr wild ist. Und irgendwie eine sehr gesunde Insel ist. Mir ging es noch nie so gut, wie während der sechs Wochen, die wir dort waren. Ich war den ganzen Tag draußen. Abends war ich immer wahnsinnig müde. Wir hatten viel Glück mit dem Wetter. Wir sind viel barfuß gelaufen, am Strand und in den Dünen. Das ist gut für die Füße. Außerdem fehlt Amrum im Gegensatz zu Sylt die Landanbindung. Das macht sie irgendwie noch abgelegener und eben ursprünglicher.
- In Hamburg habt ihr auch gedreht?
Ja, die Studioaufnahmen. Das ist dann immer ein Heimspiel.
- Wieder spielt Diane Kruger mit, die in „Aus dem Nichts“ in der Hauptrolle zu sehen war. Sie spielt die selbstbewusste, anti-faschistische Bäuerin Tessa. Wie kam es zu der Besetzung?
Sie hat sich die Rolle ausgesucht. Wir vertrauen jeweils auf den Instinkt des anderen. Und ihr Instinkt hat ihr gesagt, dass Tessa ihre Rolle ist.
- Auch sonst ist der Film prominent besetzt, neben Laura Tonke, Lisa Hagmeister und Matthias Schweighöfer, auch mit deinen norddeutschen Regiekollegen Detlev Buck, Jan Schütte und Lars Jessen. Der hat noch nie geschauspielert, oder?
Ich glaube, das war seine erste Rolle. Und, naja, ich dachte es ist ganz gut, wenn noch andere Regisseure am Set sind, die für mich einspringen, wenn ich da an der Nordsee eine Erkältung oder so bekomme. Das waren also ganz pragmatische Gründe. Ich schätze sie natürlich auch als Schauspieler.
- Was wünscht du dir für den Film – in Cannes und dann auch zum Kinostart im Oktober?
Natürlich viele Zuschauer, und vor allem ein breites Publikum – auch Kinder, zumindest ab zwölf Jahren, weil der Film so viele Geschichten zu erzählen hat. Durchs Erzählen lernen wir. Wir vergessen so schnell und denken immer, dass wir alle entnazifiziert sind. Aber dem ist ja überhaupt nicht so. Ich glaube, dass der Film einerseits unterhält – das soll er auch – dass er andererseits aber auch reflektiert, wer wir sind und wo wir vor nicht allzu langer Zeit standen. Wenn man das vergisst, steht man schon wieder an der Schwelle, dass es sich wiederholt. Nichts ist zu Ende erzählt.
weitere Beiträge

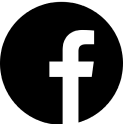

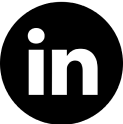
.jpeg?fit=max&w=800&h=3161&q=90&fm=webp)

