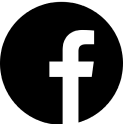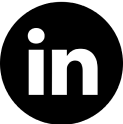"Es gibt immer Hoffnung"
02.10.2024 | Interview mit Mohammad Rasoulof

Kurz vor der Weltpremiere von „Die Saat des heiligen Feigenbaums“ in Cannes gelang dem Regisseur Mohammad Rasoulof die Flucht aus dem Iran. Inzwischen lebt er mit seiner Familie in Hamburg. Hier feierte das Drama beim Filmfest Deutschlandpremiere. Es erzählt, wie eine ganze Familie Opfer des Regimes wird - die einen in der Rebellion, der andere in der Staatstreue. Das Drama, das in Teilen in Hamburg entstanden ist, geht im kommenden Jahr für Deutschland ins Oscar-Rennen.
Interview: Britta Schmeis
- Mohammad Rasoulof, was war der Auslöser diesen Film „Die Saat des heiligen Feigenbaums“ zu machen?
Als 2022 nach der Verhaftung von Jina Mahsa Amini und ihrem Tod in Haft die Revolution „Frauen, Leben, Freiheit“ im Iran begann, war ich schon seit Monaten im Gefängnis. Ich habe mich gefragt, wie Menschen, die im System der Unterdrückung arbeiten, denken, was sie für eine Persönlichkeit haben. Und wie es dazu kommt, dass sie so anders denken als ich.
- Was hat dich dann zu der Geschichte über den Vater und Staatsanwalt inspiriert, der plötzlich das Regime über das Wohl und das Glück seiner Familie stellt?
Irgendwann waren einmal Angestellte des Staates bei uns im Gefängnis. Einer von ihnen löste sich aus der Gruppe, kam zu mir und sagte: „Ich hasse das, was ich tue. Jeden Tag, wenn ich zu meinem Job ins Gefängnis fahre, frage ich mich, wann ich mich an welchem Pfosten erhängen werde.“ Er erzählte auch, dass ihm seine Familie, seine Kinder jeden Tag kritische Fragen stellten und ihn für das, was er tut, verurteilten. Das war für mich die Inspiration zu dem Film über einen Mann, dem die Trennung zwischen seiner Arbeit für einen totalitären Staat und der Liebe und Fürsorge für seine Familie nicht mehr gelingt.
films-boutique_alamode--film.jpg?fit=max&w=1200&h=3024&q=85&fm=webp)
- Was ist für dich das zentrale Thema des Films?
Es geht um Gehorsam und um Menschen, die in einem ideologischen Umfeld arbeiten, wie der Vater, der dadurch seine eigenen moralischen Werte verliert. Er wird im Laufe des Films zu einem Symbol des Patriarchats. Die Familie wird dann zur Metapher für das Verhältnis zwischen der Zivilgesellschaft, dem Widerstand und dem Regime.
- Dabei stehen die Rollen der Frauen, also seiner Töchter und seiner Frau, im Vordergrund. Sie rebellieren, die Ehefrau allerdings weniger als die Töchter.
Ja, das ist typisch für iranische Mütter, die dafür sorgen müssen, das Gleichgewicht in der Familie zu bewahren. Das Wichtigste für sie ist, die Familie zusammenzuhalten. Das hat in der Filmfigur weniger mit ihr und ihren eigenen Vorstellungen zu tun, sondern vielmehr mit den Erwartungen der Gesellschaft. Zugleich hat sie kaum eine Beziehung zur Außenwelt. All ihre Informationen zieht sie aus den Fernsehnachrichten, die vom Regime gesteuert sind. Sie ist quasi in der Wohnung in Haft. Zumindest am Anfang überlässt sie den offiziellen Meldungen und damit dem Regime die Macht über ihre Gedanken. Das ist sehr verbreitet im Iran.
- Der Titel ist auch eine Metapher. Was hat es damit auf sich?
Vor sieben Jahren habe ich im Süden des Irans auf einer Insel diesen Feigenbaum entdeckt. Sein Lebenszyklus hat mich fasziniert. Die Früchte werden von Vögeln gefressen und die Samen in deren Kot weitergetragen. Die Saat sucht sich dann einen anderen Baum als Wirt, umschlingt ihn und erwürgt, also tötet, ihn schließlich.
- Für was steht dieses Bild?
Für mich ist es eine Metapher, die sehr offen ist und daher auch viele Deutungen zulässt, etwa dass das System auch den Boden für den Widerstand bereitet, so wie der Baum für die Feige zum Nährboden wird. Aber ich will dazu gar nicht so viel sagen, vielleicht nur, dass, dass man, egal wann im Leben, irgendwann Hoffnung finden kann. Und dass aus Schlechtem oder nicht so Schönem wie dem Kot am Ende wieder etwas Schönes, Gutes entstehen kann wie der Feigenbaum.

- Du hast den Film im Verborgenen gedreht, da du bereits mit einem Berufsverbot belegt warst und dir acht Jahre Haft und Peitschenhiebe drohten. Wie kann man sich so einen Dreh vorstellen?
Wir haben viel in Innenräumen gedreht, sodass wir nicht in der Öffentlichkeit waren. In den Szenen, die auf der Straße entstanden sind, haben unsere Darstellerinnen Kopftücher getragen. Das gehört ja auch zu der Geschichte. Wir sind bei Außendrehs sogar von Regimekritikern beschimpft worden, weil sie dachten, wir drehen einen Propagandafilm. Ich selbst war nie direkt bei diesen Aufnahmen dabei, sondern immer in der Distanz. Ich habe zum Beispiel ein paar Straßen weiter in einem Auto gesessen, sonst wäre es viel zu gefährlich für mich geworden. Im Iran geht es immer darum, nicht aufzufallen.
- Der Film ist auch in Zusammenarbeit mit Partner*innen in Hamburg entstanden. Wie hat diese Zusammenarbeit konkret ausgesehen?
Ich habe eine sehr lange und persönliche Beziehung zu Hamburg. Meine Familie, meine großartigen Produzent*innen Mani Tilgner und Rozita Hendijanian sowie viele meiner engen Freunde leben hier. Und der Hamburger Filmeditor Andrew Bird war für den Schnitt verantwortlich, auch die Postproduktion hat in Hamburg stattgefunden. Oft liefen Dreh und Schnitt gleichzeitig. Die MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein hat den Film wie schon andere zuvor gefördert. Wir standen alle ständig im Kontakt, auch als ich nicht vor Ort war. Das war eine sehr professionelle und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Hamburg ist inzwischen meine Heimat geworden.


weitere Beiträge